- Interview mit Jan-Vincent Harre
- Interview mit Jingyi Mah
- Interview mit Carolin Kimmig
- Interview mit Dane Späth
- Interview mit Andreas Bartenschlager
- Interview mit Hendrik Schmerling
- Interview mit Leonard Benkendorff
- Interview mit Kristine Lam
- Interview mit Mathilde Kervazo
Interview mit Jan-Vincent Harre

- Wie heißt du? Wo kommst du her?
Mein Name ist Jan-Vincent Harre und ich komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf in Niedersachsen namens Brüggen.
- Wie war dein Werdegang? Was hast du studiert?
Nach meinem Abitur im Jahr 2015 habe ich zunächst angefangen Maschinenbau an der TU Braunschweig zu studieren, habe mich dann aber dazu entschlossen Physik in Göttingen an der Georg-August Universität zu studieren. Dort habe ich meinen Bachelor im Institut für Astrophysik und meinen Master am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung abgeschlossen.
- Wie bist du zur Exoplanetenforschung gekommen?
Das Thema Weltraum an sich fand ich schon immer sehr faszinierend und während des Studiums ist mir dann klar geworden, dass ich das Forschungsfeld der Exoplaneten am Interessantesten finde.
- Woran forschst du?
Wir untersuchen den Orbitzerfall von sogenannten heißen Jupitern, also Gasriesen, die sich sehr nah an ihrem Stern befinden und diesen teilweise sogar in weniger als 24 Stunden umrunden. Aufgrund der Nähe zwischen den beiden Objekten kommt es zu starken Gezeitenkräften, ähnlich wie bei dem Mond und der Erde. Diese Kräfte können dafür sorgen, dass die Umlaufbahn des Planeten schrumpft („zerfällt“) und er dem Stern somit immer näherkommt.
- Welche wissenschaftlichen Fragen willst du beantworten?
Wie kommt ein jupitergroßer Planet so nah an seinen Stern?
Wie lange kann so ein Planet überleben?
Wie effizient ist dieser Mechanismus für verschiedene Sterne?
- Welche Methoden verwendest du?
Hauptsächlich die Transitmethode, weil wir die genauen Transitzeiten brauchen, also die Zeitpunkte, an denen der Planet vor dem Stern aus unserer Sicht langläuft und einen Teil von ihm verdeckt.
- Warum findest du speziell dein Forschungsthema interessant?
Weil bisher noch nicht so viel in diesem Gebiet bekannt ist, bis jetzt gibt es nur einen Planeten, bei dem dies messbar nachgewiesen werden konnte, WASP12 b. Außerdem, wer findet es nicht cool, wenn ein Planet in einen Stern stürzen kann?
- Wie kann man dieses Thema in einen größeren (wissenschaftlichen) Kontext einordnen? Wo siehst du Verbindungspunkte zwischen deinem Thema und anderen wissenschaftlichen Forschungsfeldern?
Unsere Forschung gibt uns Informationen über das Zentralgestirn im jeweiligen System. Wenn man eine genügend große Stichprobe hat, lassen sich diese Erkenntnisse auch auf andere Sterne übertragen.
- Arbeitest du regelmäßig mit anderen Projekten des SPP zusammen? Wenn ja, woran/welche Projekte? Wie greifen diese Projekte ineinander?
Bisher habe ich letztes Jahr am SPP 1992 all-hands-on-deck Meeting teilgenommen und dort ein Poster vorgestellt, dieses Jahr an der „Hands-on Numerical Astrophysics School for Exoplanetary Sciences“ Anfang Juli in Hanau und dann werde ich noch Mitte September beim „PFE-SPP 1992 joint meeting“ über „(Exo)Planet Diversity, Formation and Evolution“ teilnehmen und auch dort ein Poster vorstellen.
- Inwiefern hat der SPP-1992 mich in meiner Forschung gefördert oder unterstützt?
Der SPP-1992 ermöglicht es mir Konferenzen und Workshops zu besuchen, wie zum Beispiel die Summer School in Hanau oder auch den Carl Sagan Summer Workshop, welche beide sehr viel zu meinem Wissen und auch meiner Forschung beigetragen haben. Außerdem steht ein Netzwerk an Forschern und Experten ähnlicher, aber auch anderer Gebiete dadurch zur Verfügung.
- Was würdest du spekulieren, was man in 10 Jahren über dein Thema wissen könnte?
Vermutlich wird es einige mehr Planeten mit bestätigtem Orbitzerfall geben, da die längere Zeitskala an Messungen sehr hilfreich dafür ist, weil der Effekt, den wir messen wollen sehr klein ist – im Fall des Planeten mit
bestätigtem Zerfall sind das etwa 30 Millisekunden pro Jahr. Messungen mit neuen und noch präziseren Instrumenten werden natürlich auch dazu beitragen.
Interview mit Jingyi Mah
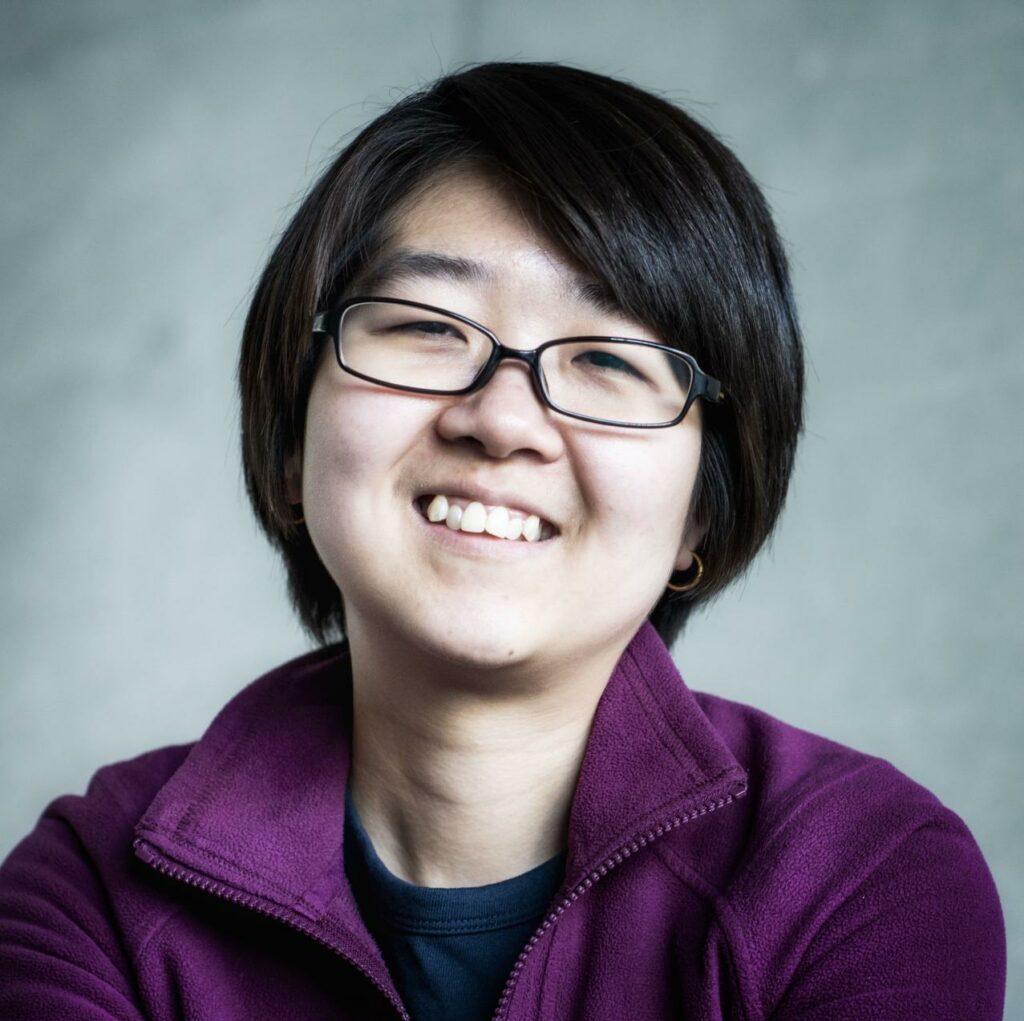
- Wie heißt du? Wo kommst du her?
Mein Name ist Jingyi Mah. Ich komme aus Malaysia.
- Für welche Einrichtung arbeitest du?
Ich arbeite für das Max-Planck-Institut für Astronomie in Deutschland.
- Wie war dein Werdegang? Was hast du studiert?
Ich habe im Grundstudium Physik studiert und mich dann im Hauptstudium für Astrophysik und Planetenforschung entschieden.
- Wie bist du zur Exoplanetenforschung gekommen?
Als ich auf der Suche nach einem geeigneten Forschungsthema für meine Masterarbeit war, stieß ich auf eine Arbeit über einen M-Zwergstern namens TRAPPIST-1, der sieben erdgroße Planeten beherbergt. Ich fand dieses Exoplanetensystem äußerst faszinierend und beschloss, seine langfristige Stabilität und seinen möglichen Entstehungsweg zu untersuchen.
- Welche wissenschaftlichen Fragen willst du beantworten?
Wie wirkt sich der Wassergehalt in protoplanetaren Scheiben auf den Ausgang der Planetenbildung aus?
Welche Rolle spielt die chemische Reichhaltigkeit des Wirtssterns bei der Bestimmung der Zusammensetzung der Planetenmasse?
- Welche Methoden verwendest du dafür?
Ich führe Simulationen von Planetenentstehungsmodellen durch, um zu sehen, ob die Ergebnisse mit den Beobachtungen übereinstimmen.
- Was reizt dich speziell an deinem Forschungsthema?
Neue Beobachtungen von Exoplaneten und Scheiben stellen die derzeitigen Theorien zur Planetenentstehung in Frage. Bestehende Modelle müssen angesichts der neuen Entdeckungen überarbeitet werden.
- Wie ist dein Forschungsthema in den größeren (wissenschaftlichen) Kontext eingebunden? Wo siehst du Verbindungen zwischen deinem Thema und anderen wissenschaftlichen Bereichen?
Das Gebiet der Planetenentstehung ist eng mit den Beobachtungen protoplanetarer Scheiben verknüpft – ein gutes Verständnis protoplanetarer Scheiben bildet die Grundlage für Planetenentstehungsmodelle.
- Welche Angebote aus dem SPP-1992 (Konferenzen, Schulungen, Networking, Vortragsreihen, etc.) hast du in Anspruch genommen?
Ich habe 2022 eine Summer School zum Thema Numerische Methoden in der Astrophysik besucht.
- Inwiefern hat das SPP-1992 dich und deine Forschung unterstützt?
Ich konnte bei einer vom SPP-1992 organisierten Sommerschule andere Wissenschaftler kennenlernen, die sich mit verschiedenen Aspekten der Planetenbildung beschäftigen.
- Kannst du dir vorstellen, welche neuen Erkenntnisse wir auf deinem Forschungsgebiet in zehn Jahren haben könnten?
Wir könnten umfassende und hochpräzise Informationen über die chemische Zusammensetzung protoplanetarer Scheiben und der Atmosphären von Planeten haben. Modelle zur Planetenentstehung könnten dann so leistungsfähig sein, dass sie den gesamten Entstehungsprozess eines Planeten – von Staubpartikeln bis hin zu einem Planeten in voller Größe – simulieren und seine mögliche Zusammensetzung vorhersagen können.
Interview mit Carolin Kimmig

- Wie heißt du? Wo kommst du her?
Hi, ich bin Carolin Kimmig, aber eigentlich kennen mich alle unter meinem Spitznamen Lina. Ich bin in Tübingen aufgewachsen und habe in Heidelberg studiert.
- An welcher Institution arbeitest du?
Ich arbeite als Doktorandin am Institut für Theoretische Astrophysik (ITA) in Heidelberg, das Teil des Zentrums für Astronomie Heidelberg (ZAH) ist. Am ITA gibt es mehrere Arbeitsgruppen, die sich unterschiedlichen Themen widmen, wie zum Beispiel Planetenentstehung, Sternentstehung oder gar die Entstehung von Galaxien.
- Was hast du studiert?
Ich habe Physik an der Universität Heidelberg studiert. Während des Studiums habe ich mich schon sehr für Astrophysik interessiert, weshalb ich viele Wahlkurse in diesem Bereich belegt habe.
- Wie bist du zur Exoplanetenforschung gekommen?
Planeten haben mich schon immer fasziniert. Nach einer interessanten Vorlesung zu Exoplaneten habe ich mich nach Arbeitsgruppen in diesem Fachbereich umgeschaut. In zwei der Arbeitsgruppen konnte ich dann als Bachelorstudentin reinschnuppern, indem ich das wöchentliche Gruppentreffen besuchen durfte. Die Themen, die dort besprochen wurden, haben mich so begeistert, dass ich beschlossen habe, meine Bachelor- und Masterarbeit in dem Themengebiet zu schreiben.
- Woran forschst du?
Ich arbeite an Protoplanetaren Scheiben; das sind Scheiben aus Gas und Staub, die zusammen mit einem Stern entstehen. In solchen Scheiben können unter bestimmten Bedingungen Planeten entstehen, wenn Staub zusammenklumpt und immer weiter wächst. Die Bedingungen für Planetenentstehung sind aber mit vielen komplexen physikalischen Prozessen verbunden, die noch nicht komplett erforscht sind.
- Welche wissenschaftlichen Fragen willst du beantworten?
Im Speziellen möchte ich die physikalischen Prozesse erforschen, die in Protoplanetaren Scheiben auftreten können. Gas und Staub in den Scheiben ist äußeren Einflüssen ausgesetzt, zum Beispiel vom Stern, von eventuell schon entstandenen Planeten, oder Magnetfeldern. Ich möchte einen Teil dazu beitragen, die Prozesse besser zu verstehen.
- Welche Methoden verwendest du?
Da ich im Bereich der theoretischen Astrophysik arbeite, arbeite ich viel mit Computersimulationen. Dafür erstelle ich ein Modell von der Scheibe, die ich untersuchen will, und lass den Computer ausrechnen, was mit der Scheibe unter welchen Einflüssen passiert. Es gibt öffentliche („open-source“) Computerprogramme, die von anderen Wissenschaftler:innen geschrieben wurden und die ich nutzen kann, aber manchmal schreibe ich auch meine eigenen Programme, um einen bestimmte Aspekte zu untersuchen. Um die theoretischen Modelle zu vergleichen und zu verifizieren, sind Beobachtungen essenziell, weshalb die Zusammenarbeit mit Beobachter:innen sehr wichtig ist.
- Warum findest du speziell dein Forschungsthema interessant?
Ich bin davon fasziniert, wie viele unterschiedliche Protoplanetare Scheiben schon beobachtet wurden. Es gibt Scheiben in allen Größen, Scheiben mit Ringen, mit Spiralarmen oder mit Schatten und anderen nicht symmetrischen Eigenschaften. Auch die Vielfalt der physikalischen Prozesse in den Scheiben ist riesig. Ich finde es spannend, herauszufinden, in welchen Scheiben welche Prozesse dominieren können.
- Wie kann man dieses Thema in einen größeren (wissenschaftlichen) Kontext einordnen?
Die Menschen sind von Natur aus neugierig. Große Fragen sind zum Beispiel: Wo kommen wir her? Wie könnte die Erde entstanden sein? Ist es möglich, dass andere Planeten unter ähnlichen Bedingungen entstehen können? Solche Fragen können innerhalb meines Forschungsfeldes (zumindest ein Stück weit) beantwortet werden.
- Wo siehst du Verbindungspunkte zwischen deinem Thema und anderen wissenschaftlichen Forschungsfeldern?
Die Forschung an Protoplanetaren Scheiben ist ganz eng gekoppelt mit der Entstehung von Sternen, da sie zusammen entstehen. Deshalb ist die Umgebung und Art und Weise der Sternentstehung maßgeblich für die Form und Zusammensetzung der Scheibe.
Weiterhin sind die physikalischen Prozesse in Protoplanetaren Scheiben oft ähnlich zu Prozessen in anderen Scheiben, beispielsweise in Scheiben um Schwarze Löcher oder Galaxienscheiben. Hier werden oft Parallelen gezogen.
- Arbeitest du regelmäßig mit anderen Projekten des SPP zusammen? Welche Angebote des SPP-1992 (Konferenzen, Schulungen, Vernetzungstreffen, Weiterbildungen, Vorträge, etc.) hast du genutzt?
Ich war Teilnehmerin einer Sommerschule zu Exoplaneten, die von dem SPP-1992 organisiert wurde. Dort habe ich viel gelernt und konnte viele verschiedene Computerprogramme ausprobieren, um unterschiedliche Aspekte von Exoplaneten zu simulieren. Außerdem hatte ich die Möglichkeit, an einer Konferenz des SPP-1992 teilzunehmen, bei der ich viele wissenschaftliche Diskussionen über andere Projekte sowie mein Projekt führen konnte.
- Inwiefern hat der SPP-1992 mich in meiner Forschung gefördert oder unterstützt?
Ein Forschungsnetzwerk wie der SPP-1992 ist eine sehr gute Gelegenheit, Kolleg:innen kennenzulernen. Die Wissenschaft lebt vom Austausch und Diskussionen, so konnte ich schon viele Anstöße zu neuen Forschungsfragen in meinem Projekt bekommen. Der SPP-1992 hat mir ermöglicht, mich mit Kolleg:innen auf der Sommerschule und der Konferenz auszutauschen.
- Was würdest du spekulieren, was man in 10 Jahren über dein Thema wissen könnte?
Das Feld um Protoplanetare Scheiben ist zur Zeit sehr im Wandel. Vor 10 Jahren gab es noch keine aufgelösten Beobachtungen von Scheiben, man konnte sie nur indirekt detektieren. Deshalb glaube ich, dass man in 10 Jahren so viele und bessere Beobachtungen hat, dass man viel genauere Aussagen über die Prozesse in Protoplanetaren Scheiben treffen kann. Außerdem denke ich, dass wir noch mehr Planeten direkt im Entstehungsprozess beobachten können; bislang sind nur zwei oder drei Scheiben mit gerade entstehenden Planeten entdeckt.
Interview mit Dane Späth
- Bitte stell dich einmal kurz vor
Mein Name ist Dane Späth, ich bin Promotionsstudent an der Landessternwarte in Heidelberg, dort habe ich auch studiert, gebürtig bin ich aber aus Ulm.
- Wie war dein Werdegang?
Studiert habe ich ursprünglich Physik, in Heidelberg. Das war einfach von der Schule aus schon immer das, was mich irgendwie begeistert hat, aber schon immer mit dem Hintergrund, dass ich eigentlich in die Astronomie will. Das war schon immer das, was mich am meisten interessiert hat, schon als Kind im Planetarium und so. Und dann hab ich also Physik studiert, bin dann schon während der Bachelorarbeit zum ersten Mal ein bisschen in die Exoplaneten-Richtung gekommen, an der Sternwarte. Dort konnte ich dann auch glücklicherweise ein cooles Masterprojekt machen, wo ich an einem Teleskop gearbeitet habe. Und nach einer kurzen Pause, wo ich zwischenzeitlich mal ein Jahr gearbeitet habe, bin ich dann wieder zurückgekommen in die Wissenschaft. Der Spaß am wissenschaftlichen Arbeiten war einfach da und ich hatte wieder Lust, mich mit den Exoplaneten zu beschäftigen.
- Was ist dein Forschungsthema?
Ich suche nach Planeten um Riesensterne. Das sind sehr alte, entwickelte Sterne. Unsere Sonne beispielsweise ist ja gerade in einem langlebigen Stadium, sie brennt gerade Wasserstoff zu Helium im Kern. Irgendwann wird das enden, in 5 Milliarden Jahren oder so, und dann wird die Sonne anfangen sich auszubreiten und irgendwann anfangen, Helium weiter zu brennen. Mein Ziel ist es also, Planeten zu finden um diese Art von Sternen. Da kennen wir auch schon ein paar, aber wir wollen eben verstehen, wie die Planetensysteme, die dann noch existieren, beeinflusst werden von der Entwicklung des Sterns. Das ist so das Grundziel unserer Forschung.
- Welche Methoden verwendest du?
Ich habe mehrere Projekte in dem Bereich. Das eine ist eine Mischung aus Transitmethode und Radialgeschwindigkeitsmethode, wir suchen da in TESS-Daten. Das ist ein Transit-Satellit, der ein großes Sample aus Sternen gleichzeitig beobachtet und nach periodischen Änderungen in der Helligkeit sucht, die durch Planeten verursacht werden können. Dann suchen wir dort in den vielversprechenden Zielen die raus, die Riesensterne sind, und wollen die dann nach-beobachten mit der Radialgeschwindigkeitsmethode. Dort wird die Verschiebung von Spektrallinien in Spektren gesucht und damit kann man dann die Masse des Planeten bestimmen, und die Transitmethode gibt einem den Radius des Planeten. Diese Methode nutze ich auch für noch ein etwas anderes Projekt, wo wir tatsächlich an der Sternwarte selbst mit einem Teleskop arbeiten, wo ich auch ein bisschen an der Instrumentierung beteiligt bin. Aber ich benutze andererseits auch wieder Computermodelle, um Messungen, die wir haben, am Schluss wieder zu deuten, also das ist ein sehr vielseitiges Arbeitsfeld, würde ich sagen.
- Warum hast du dieses Thema gewählt?
Also prinzipiell finde ich Planeten einfach spannend. Ich finde super-cool, was gerade so am Anfang meines Lebens losging, diese Suche nach Exoplaneten, und wie viel man in den letzten Jahren gelernt hat. Dass ich jetzt speziell nach Planeten um Riesensterne suche, finde ich vor allem deswegen interessant, weil uns das auch viel über unser eigenes Sonnensystem sagt. Wir wollen ja verstehen, was passiert mit unserem Planeten, wenn die Sonne sich entwickelt? Das ist zwar noch lang hin, aber die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, neben irgendwelchen Simulationen, ist zu versuchen zu verstehen, wie diese Systeme um diese Art von Sternen aussehen. Ich finde, das hat deswegen auch relativ viel Bezug auf uns selbst. Wobei ich auch sagen muss, ich finde es einfach spannend, Planeten in möglichst vielseitigen Bedingungen zu finden und um jede Art von Stern zu kennen. Man darf sich nicht nur auf eine kleine Nische fokussieren und immer nur zu sagen “erdähnliche Planeten um sonnenähnliche Sterne”. Man darf gerne auch ein bisschen weiter suchen und auch versuchen, verschiedene Dinge zu finden.
- Wie verbindet sich den Thema mit anderen Forschungsfeldern?
Womit wir sehr viel zusammenarbeiten, ist Modellierung, zum Beispiel dynamische Modelle, was passiert, wenn der Stern sich entwickelt. Insofern sind wir als diejenigen, die jetzt so einen Planeten um eine bestimmte Art von Stern suchen, sehr abhängig von Leuten, die Modelle aufstellen und die Hydrodynamik und damit den Stern an sich simulieren. Andererseits hängen wir wieder stark ab von Wissenschaftlern, die sich dynamische Modelle überlegen: Was passiert denn mit einem Planeten, der relativ nah am Stern ist, wenn der sich ausbreitet? Da haben wir sehr viele Schnittpunkte. Ansonsten sind wir noch eher in einem Bereich, wo wir noch nicht so viel über unsere Planeten wissen. Das ist den Sternen, die wir beobachten, geschuldet, die wollen nicht so leicht preisgeben, was in ihnen steckt. Insofern sind wir da noch nicht so weit, dass wir viel mit geologischen Modellen zusammenarbeiten können. Da fehlt aktuell noch ein bisschen die Datenlage.
- Hast du Verbindungen zu anderen SPP-Projekten?
Das habe ich aktuell nicht so viel. Prinzipiell sind wir, glaube ich, in der Planeten-Community ein kleineres Feld, weil wir eine ganz bestimmte Art von Sternen angucken. Das SPP ist derzeit eher auf das Verständnis von einzelnen Planeten fokussiert. Wie kann man das modellieren? Wie entsteht dieser Planet? Und so weiter. Da sind wir, glaube ich, einfach dadurch, dass die Sterne nicht ganz so leicht hergeben wollen, was in ihnen steckt, nicht ganz so gut darin, das zu verbinden. Aber ich hoffe, dass wir da in einigen Jahren noch hinkommen können.
- Welche Angebote des SPP hast du genutzt?
Letztes Jahr und dieses Jahr war jeweils eine Konferenz vom SPP und das waren jeweils ganz tolle Veranstaltungen, weil man einfach mal den Blick ein bisschen hebt und auf ganz andere Felder blickt und man hat wirklich die Experten da sitzen, die sich mit diesen Feldern beschäftigen. Es ist immer super spannend, einen Einblick zu kriegen, was da gemacht wird. Das ist vielleicht oft nicht so direkt anwendbar auf die eigene Forschung, aber es ist einfach super, um sich ein bisschen zu erweitern in seinem Verständnis dieser ganzen doch recht komplizierten Materie. Außerdem hab ich natürlich auch das Webinar, das das SPP immer anbietet, regelmäßig besucht, weil es auch immer relativ spannende Vorträge gab, und natürlich mit dem Outreach-Team war ich gelegentlich in Verbindung, und da ist auch ganz spannend zu sehen, was da gemacht wird, um die Wissenschaft auch nach außen zu vermitteln. Für mich als noch junger Student ist das super spannend zu sehen, was es da für Möglichkeiten gibt und von den Experten zu lernen.
- Konnte der SPP deine Forschung unterstützen?
Erstmal überhaupt die Möglichkeit zu haben, die Forschung zu machen, ist ja allein schon großartig. Und dann das Netzwerk, das man kriegt, man hat ein Netzwerk, wo man Leute fragen kann, wenn man zu bestimmten Themen Fragen hat. Dazu die Möglichkeit, auf diese Konferenzen zu fahren und dort viel zu lernen. Auch wenn man das vielleicht nicht direkt in seiner Forschung braucht, ist das für mich ein Mitgrund, zu promovieren, weil man die Chance hat, so etwas zu lernen. Und man lernt einfach viele nette Leute kennen, das macht total viel Spaß und es ist total motivierend, wenn man coole Kontakte knüpft.
- Was könnte man in 10 Jahren über dein Thema wissen?
Das ist natürlich immer die schwierigste Frage. Ich hoffe schon, dass wir durch neue Methoden oder Verbesserung der Methoden, die wir haben, unser Bild deutlich verbessern können, auch dass wir noch viel mehr Planeten finden. Wir kennen gerade nur ungefähr 140 Planeten um Riesensterne, das ist im Vergleich zu fast 5000, die wir um Hauptreihensterne kennen, ein sehr kleines Sample. Wir brauchen eine größere Menge, um statistisch die Parameter herauszufinden, zu verstehen, welche Parameter was beeinflussen, das fehlt uns noch. Ich denke schon, dass immer bessere Teleskope mit super hochauflösenden Spektrographen, wie Gaia oder Espresso zum Beispiel, dass neue Teleskope und neue Instrumente uns dabei helfen, viel, viel mehr zu finden und dann auch die statistische Aufarbeitung voran zu treiben. Ich denke, dass wir dann schon in Bereiche kommen, wo wir dann sehr genau vorher sagen können, was mit einem bestimmten System passiert, wenn man weiß, der Stern wird sich so-und-so entwickeln. Welche Planeten werden überleben? Welche werden vielleicht verschluckt? Das wäre, denke ich, so das, was man sich in zehn Jahren schon erhoffen kann.
- Welche Hobbys hast du außerhalb der Wissenschaft?
Ich spiele tatsächlich Handball im Verein, auch auf Wettkampfebene und so; das macht mir viel Spaß und ist auch ein super Ausgleich. Generell mache ich relativ gerne Sport, also gehe zum Beispiel gern schwimmen. Und während der Corona-Pause, wo man ja vieles nicht machen konnte, habe ich mir überlegt, dass ich gerne Klavier lernen würde und hab mir dann ein E-Piano zugelegt und angefangen, mir Klavier selbst beizubringen. Ich bin ganz zufrieden damit, sage ich mal, man könnte es noch verbessern, aber das macht mir auch sehr viel Spaß.
Interview mit Andreas Bartenschlager
- Wie heißt du? Wo kommst du her?
Mein Name ist Andreas Bartenschlager und ich komme aus der Nähe von Augsburg in Bayern.
- An welcher Institution arbeitest du?
Ich bin seit März diesen Jahres Doktorand am Karlsruher Institut für Technologie in der Abteilung Meteorologie und Klimaforschung, in dem Unter-Department Atmosphärische Spurenstoffe und Fernerkundung.
- Wie war dein Werdegang?
Ich habe an der LMU in München Physik studiert, Bachelor und Master. In meinem Bachelor hatte ich den Schwerpunkt Astrophysik und in meinem Master dann Atmosphärische Physik. Bei Exoplaneten hat sich dann ergeben, dass die Kombination aus Astrophysik und Atmosphärischer Physik zu dem Thema geführt hat.
- Was ist dein Forschungsthema?
Wir in Karlsruhe versuchen mit Hilfe eines [Computer-]Modells für Exoplaneten die Zusammensetzung der Atmosphäre hinsichtlich des Einflusses von kosmischer Strahlung und Sonnenstürmen zu untersuchen. Dazu verwenden wir ein Modell in Kooperation mit dem DLR in Berlin und der Universität zu Kiel, die uns dann mit Daten dazu füttern.
- Welche wissenschaftliche Frage willst du beantworten?
Speziell beantworten möchten wir den Einfluss von kosmischer Strahlung auf die Zusammensetzung der Atmosphäre hinsichtlich der Ionenchemie, und was das dann für einen Einfluss auf die neutrale Zusammensetzung der Atmosphäre hat, mit der man dann später Transmissionsspektren berechnen kann, die dann durch James Webb beobachtbar werden.
- Warum hast du dieses Thema gewählt?
Spannend ist das dahingehend, dass es im Universum viele (Exo-)planeten mit einem breiten Zoo an atmosphärischen Zusammensetzungen gibt, sei es Venus, Mars, oder dann fernere Exoplaneten. Das, zusammen mit der Kombination aus Astrophysik und Atmosphärischer Physik, hat mich daran gereizt.
- Wie verbindet sich dein Thema mit anderen Forschungsfeldern?
Die Verbindungswege würde ich so einschätzen, dass man das auch in Kombination mit Geowissenschaften machen kann, also wie die Geophysik der Exoplaneten mit der Atmosphäre wechselwirkt, oder auch mit Heliophysik, dass man den Einfluss der Sonne oder des Heimatsterns auf die obere Atmosphäre von Exoplaneten betrachtet.
- Welche Angebote des SPP 1992 hast du genutzt?
Bisher hab ich an den Seminarvorträgen teilgenommen, die vom Schwerpunktprogramm ausgingen, und das hier [PFE-SPP1992 joint meeting in Berlin] ist meine erste Konferenz mit persönlicher Anwesenheit, zuvor waren es nur Online-Konferenzen und auch relativ kleine, also das hier ist die erste größere Konferenz an der ich teilnehme.
- Konnte der SPP 1992 deine Forschung unterstützen?
Auf jeden Fall, es gibt Schnittmengen zu anderen Schwerpunktprojekten, die man in Zukunft denke ich mal nutzen kann, um sich besser zu vernetzen.
- Was könnte man in 10 Jahren über dein Thema wissen?
Also ich gehe davon aus, dass in zehn Jahren vermutlich mehr Exoplaneten gefunden werden, auch welche mit ganz verschiedenen Atmosphären, und deren genaue Zusammensetzung, was jetzt durch den Start von James Webb verifiziert werden kann.
- Welche Hobbys hast du außerhalb der Wissenschaft?
Ich spiele ganz gern Fußball in meinem Heimatdorf; das ist zwar nur ein kleiner Verein, aber zur Zeit läuft es relativ gut und mal schauen, wohin das führt.
Interview mit Hendrik Schmerling
- Bitte stell dich einmal kurz vor
Mein Name ist Hendrik Schmerling und ich komme aus Köln.
- An welcher Institution arbeitest du?
Ich arbeite als PhD-student [Doktorand] am Rheinischen Institut für Umweltforschung.
- Wie war dein Werdegang?
Ich habe tatsächlich nicht mit Astronomie angefangen, sondern mit Meteorologie; und das kam dann eher als Zufall, dass ich mit der Astronomie begonnen habe.
- Wie bist du zur Exoplanetenforschung gekommen?
Es war tatsächlich so, dass eine Vorlesung angeboten wurde an unserer Universität; und das klang sehr interessant für mich, also habe ich da mitgemacht und im Nachhinein den Professor gefragt, ob ich nicht als Student bei ihm arbeiten könne. Das habe ich dann natürlich auch getan, er war so freundlich mir diese Stelle tatsächlich zu geben. Und im Nachhinein wurde mir dann eine PhD-Position angeboten, die ich natürlich sofort angenommen habe.
- Bitte beschreibe kurz dein Forschungsthema.
Ich arbeite vor allem an der Entdeckung von Planeten, indem ich die Daten von Weltraumteleskopen auswerte, um zu versuchen, neue Exoplaneten zu finden. Aber teilweise mache ich auch atmosphärische Modellierung.
- Welche wissenschaftlichen Fragen willst du beantworten?
Also natürlich ist das Interessanteste dabei, wie die anderen Planeten, also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems aufgebaut sind, wie viele es davon gibt und welche Diversität sie alle haben.
- Welche Methoden verwendest du?
Wie vorhin schon erwähnt, vor allem geht es darum, die Daten von Weltraumteleskopen auszuwerten. Teilweise werden auch mit anderen Teleskopen, die in Italien oder in der Atacama-Wüste stehen, genutzt, um das noch einmal zu bestätigen.
- Warum findest du speziell dein Forschungsthema interessant?
Ach, da könnte ich jetzt natürlich ganz viel sagen, aber es ist vor allem die Entdeckung des Unbekannten, die da das Meiste und das Beste daran ist.
- Wie verbindet sich dein Thema mit anderen Forschungsfeldern?
Vor allem geht es darum, zu überprüfen, wo wir herkommen und wohin wir gehen. Und da sind Exoplaneten eines der wichtigsten Bestandteile und Puzzlestücke, um die generelle Existenz der Erde und der Planeten und Sterne allgemein zu überprüfen und einfach zu erfahren, wie das alles zusammen hängt, wie das Universum aufgebaut ist, und besonders halt Planeten.
- Arbeitest du regelmäßig mit anderen Projekten des SPP 1992 zusammen?
Ich arbeite vor allem natürlich mit meiner Arbeitsgruppe zusammen, aber auch mit einer Arbeitsgruppe aus Tübingen, und dort geht es dann worklich um die atmosphärische Modellierung, denn die sind Experten auf dem Gebiet der Strahlungsübertragung und haben da eigene Programmcodes für geschrieben, die ich gerne benutze. Und deshalb muss ich da immer mal wieder nachfragen, wie das eigentlich gemacht wird.
- Welche Angebote des SPP 1992 hast du genutzt?
Tatsächlich noch nicht so viele, denn ich habe genau während der Corona-Pandemie begonnen mit meinen Studien, und da wurde das ein wenig zurückgefahren mit den gemeinsamen Treffen, und Summer Schools, Workshops und sowas. Bisher habe ich da eher nur an online-Angeboten teilgenommen, vor allem die Webinare und die gemeinsamen Konferenzen.
- Konnte der SPP 1992 deine Forschung unterstützen?
Also ich werde natürlich zum Teil von den Geldern bezahlt, das würde ich schon als sehr gute Unterstützung bezeichnen. Aber auch die gesamte Expertise, die hier vorherrscht, ist von unglaublicher Bedeutung für mich, denn alleine könnte ich mich gar nicht auf die Sachen konzentrieren und ich wüsste auch noch so wenig über dieses Gebiet, wenn mir nicht die anderen Forscher in dem SPP geholfen hätten.
- Was könnte man in 10 Jahren über dein Thema wissen?
Natürlich hat man in 10 Jahren noch viel mehr Planeten gefunden als das heute schon der Fall ist, und dann hoffe ich doch auch, dass aufgrund dessen man noch viel besser weiß, wie sich Planeten gebildet haben, wie viele Planeten es im Universum und in der Milchstraße gibt und wie solche Sonnensysteme dann aufgebaut sind.
- Welche Hobbies hast du außerhalb der Wissenschaft?
Ich hab‘ tatsächlich einige Hobbies. Neben dem Skaten, vor allem mit Inlinern, fahre ich sehr gerne Fahrrad, aber ich spiele auch auf der Ukulele.
Interview mit Leonard Benkendorff
- Bitte stell dich einmal kurz vor
Hi, ich bin Leonard Benkendorff. Ich komme ursprünglich aus Dresden, aber ich wohne jetzt in Heidelberg.
- An welcher Institution arbeitest du?
Ich arbeite am ARI, das Astronomische Recheninstitut am Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg; und ich bin Masterstudent, also schreibe meine Masterarbeit dort.
- Wie war dein Werdegang?
Ganz klassisch habe ich auch in Heidelberg angefangen, Physik zu studieren, und ich studiere jetzt auch im Master Physik mit dem Schwerpunkt Computational Astrophysik.
- Wie bist du zur Exoplanetenforschung gekommen?
Ja das war eigentlich ein Zufall. Und zwar habe ich bei meinem jetzigen Betreuer eine Vorlesung über die Methoden der Computational Physik, also wie man mit Computern Sachen simuliert, gehört, und hab ihm dann gesagt: Hey cool, kann ich meine Bachelorarbeit dort schreiben? Dadurch bin ich in dieses Thema Planeten, und die Dynamik der Planeten, mehr oder weniger reingerutscht, aber es hat mich so fasziniert, dass ich auch jetzt noch gern dran forsche.
- Bitte beschreibe kurz dein Forschungsthema.
Das ist ein wenig kompliziert. Und zwar gibt es eine ganz spezielle Kategorie von Planeten, die nennt sich ‚Hot Jupiters‘, zu Deutsch so viel wie ‚Heiße Jupiter‘, die sind eigentlich viel zu nah am Stern, als dass man sie erklären könnte. Ich mach‘ da Simulationen und versuche zu erklären, wie die durch Mechanismen da reinkommen. Und außerdem noch forsche ich an der Dynamik von Planetensystemen in so genannten Sternenhaufen, also wo viele Sterne sehr eng zusammen sind.
- Welche wissenschaftlichen Fragen willst du beantworten?
Ich will beantworten, wie diese Planeten, die ich gerade beschrieben habe, dahin kommen und ich will meinen Teil dazu beitragen, wie man sich diese ganze Planetenformation und wo sie jetzt gemessen werden, vorstellen kann und so ein größeres Gesamtbild sich daraus ergibt.
- Welche Methoden verwendest du?
Ich benutze die so genannten N-Body-Simulartionen. Das N-Body steht für eine ganze Anzahl von Körpern, also Planeten aber auch die Sterne im Sternhaufen; es wird die Gravitation zwischen denen simuliert mit Computern, sehr präzise und dafür relativ schnell, und dann mache ich Computersimulationen und erstelle darauf basierend Modelle.
- Warum findest du speziell dein Forschungsthema interessant?
Ich find’s interessant, weil gerade diese Planeten, die ich untersuche, oder auch die Gravitation von Sternenhaufen auf Planetensysteme, überhaupt noch gar nicht so richtig erforscht und verstanden ist und ich find’s wahnsinnig spannend, da einfach an etwas zu forschen, was wirklich noch offene Fragen hat und wozu ich auch das Gefühl hab‘, etwas beitragen zu können.
- Wie verbindet sich dein Thema mit anderen Forschungsfeldern?
Wir versuchen ja die Frage zu beantworten, woher kommt diese enorme Diversität von Planeten, und da trägt mein Thema bei, in Verbindung zum Beispiel auch mit den Observations, also den Beobachtungen, die erstmal diese Planetenkategorie, die ich modelliere, entdeckt habe. Und zusätzlich die Methoden, die ich verwende, das nennt sich auf Deutsch Gezeitenkräfte, oder Tidal Dissipation im Englischen, werden jetzt auch verwendet, um zu beantworten, ob Leben auf Monden möglich ist, die zum Beispiel jupiterartige Planeten umkreisen.
- Arbeitest du regelmäßig mit anderen Projekten des SPP 1992 zusammen?
Eine direkte Zusammenarbeit bestand nicht, aber ich habe immer wieder, gerade auf Konferenzen, die Expertise von anderen mir einholen können und auch viele Fragen, die mir noch unklar waren, gerade auch im größeren Kontext, dadurch sehr gut beantworten können.
- Welche Angebote des SPP 1992 hast du genutzt?
Ich war auf zwei Konferenzen jetzt schon, und da gab es einen unheimlich großen Pool an wissenschaftlichem Austausch und auch wissenschaftlichen Vorträgen, gerade im größeren Kontext, was mir sehr viel gebracht hat auch für meine Arbeit, und zusätzlich habe ich dann noch Angebote speziell für junge Forscher angenommen, zum Beispiel die Rhetorikschulung oder Präsentationsschulung, oder auch einfach nur Network-Meetings enthalten haben.
- Konnte der SPP 1992 deine Forschung unterstützen?
Zum einen kommen auch bei mir teilweise die Gelder für die Computer, mit denen ich die Simulationen mache, erst daher; das ist das Eine, das rein monetäre-technische. Aber natürlich auch durch die Forschungscommunity, durch die Connections, das hat mir enorm viel Wissen vermittelt und auch mich als unerfahrenen Masterstudenten unheimlich dabei unterstützt, jetzt schon in die aktive Forschung zu gehen.
- Was könnte man in 10 Jahren über dein Thema wissen?
Das ist eine gute Frage. Ich stelle mir vor, dass man darüber weiß, über diese ganzen Heißen Jupiter, wo die jetzt genau herkommen, beziehungsweise wie die entstanden sind, und dadurch sich auch andere Planetentheorien erklären kann. Und ich hoffe auch wesentlich besser zu verstehen, wie sich die Sternenhaufen und die Planetensysteme, die sich darin bilden, beeinflussen, was bisher noch sehr unklar ist.
- Welche Hobbies hast du außerhalb der Wissenschaft?
Ich mache sehr gerne Sport; ich spiele Fußball im Verein und geh‘ auch im Sommer regelmäßig Kitesurfen. Und nebenbei spiele ich noch Schach und Klavier.
Interview mit Kristine Lam
- Bitte stell dich einmal kurz vor
Ich bin Kristine Lam und ich komme aus dem Vereinigten Königreich.
- An welcher Institution arbeitest du?
Derzeit arbeite ich als Postdoc am Institut für Planetenforschung am DLR Berlin.
- Wie war dein Werdegang?
Ich habe mit meinem Bachelorstudium an der Queen Mary University in London angefangen, und habe dort Physik studiert. Im Verlauf meines Studiums habe ich mich auf viele Module der Astronomie konzentriert und hatte damals auch viele Berührungspunkte mit Planetenphysik, und habe auch Projekte und Arbeiten in der Planetenforschung übernommen, zur Erforschung der Planeten des Sonnensystems. Ich hatte außerdem Erfahrung mit Praktika in Sternwarten, das war es, was mein Interesse an Astronomie allgemein begonnen hat. Letztlich habe ich mich entschieden, auch in Physik zu promovieren, wobei ich mich auf die Erforschung von Exoplaneten konzentriert habe.
- Was ist dein Forschungsthema?
Im Moment richtet sich mein Projekt auf die Entdeckung und Charakterisierung von Exoplaneten. Ich benutze eine Technik namens Transitmethode, bei der wir die Helligkeit des Sterns messen und versuchen, ein Signal zu finden, wenn ein Teil des Sternenlichts vom Planeten geblockt wird. Wenn wir dieses Signal in den Daten finden, können wir das als Planetenkandidat kategorisieren und wir verfolgen das weiter mit der sogenannten Radialgeschwindigkeitsmethode vom Boden aus, bei der wir das “wackeln” des Sterns messen um zu bestätigen, dass unser Signal echt ist und von einem Planeten stammt.
- Gibt es eine bestimmte Planetenart, auf die sich deine Forschung konzentriert?
Ja, derzeit konzentriere ich mich auf eine Unterklasse der Exoplaneten, die eine so genannte ultrakurze Periode besitzen. Kurz gesagt, diese Planeten haben eine Umlaufzeit um den Stern von weniger als einem Tag. In Begriffen der Erde haben sie ein Jahr, das einen Tag oder weniger dauert. Diese Planeten sind interessant für mich, weil sie sehr nah an ihrem Stern sind, sie sind also einer signifikanten Menge stellarer Strahlung ausgesetzt, sodass sie durchgehend von Hitze und anderer Strahlung und so weiter bombardiert werden. Wir vermuten, dass diese Planeten vermutlich ihre ganze Atmosphäre von der Oberfläche verloren haben. Sie könnten also Lava-Welten sein, und sie sind einige der extremsten Exoplanetensysteme, die wir kennen.
- Warum findest du gerade dieses Thema interessant?
Also um das noch etwas auszuführen, diese Planeten mit ultrakurzer Periode sind besonders, weil wir kein Gegenstück im Sonnensystem haben. Es ist also spannend, dass wir nicht wissen, woher sie kommen, wie sie so nah am Stern gebildet werden. Wir wissen nicht, wie lange sie so nah am Stern überleben können. Höchstwahrscheinlich sind die Zusammensetzung der Oberfläche und des Inneren dieser Planeten anders als im Sonnensystem. Es ist also interessant, diese Population von Planeten als Ganzes zu verstehen und außerdem zu vergleichen, inwiefern sie anders und einzigartig im Vergleich zu unserem eigenen Planetensystem sind.
- Wo siehst du Verbindungspunkte zwischen deinem Thema und anderen wissenschaftlichen Forschungsfeldern?
Was Exoplaneten angeht, kennen wir bisher über 5000, und es ist interessant, statistische Studien anzustellen, um zu sehen, was es da draußen für Planeten gibt. Indem wir diese Art von Beobachtungsstudie durchführen, können wir die Modelle und Theorien darüber einschränken, wie diese Planeten sich gebildet oder zu ihrem derzeitigen Zustand entwickelt haben. Damit haben wir eine Menge Verbindungen mit der theoretischen Seite. Mit dem Fortschritt in Messinstrumenten – zum Beispiel wurde kürzlich das James Webb Space Telescope gestartet – können wir außerdem erforschen, was für Atmosphären einiger dieser Planeten haben könnten, wir können also unsere Studien mit den Atmosphärenmodellen da draußen integrieren. Und um zum Sonnensystem zurück zu kehren, wir können außerdem das, was wir durch Exoplaneten gelernt haben, nutzen, um einige Randbedingungen für die Entstehungstheorien zu formulieren.
- Arbeitest du regelmäßig mit anderen Projekten des SPP zusammen? Wenn ja, woran? Wie greifen diese Projekte ineinander?
Was das SPP angeht, haben wir zum Beispiel mit Gruppen aus München gearbeitet, um deren Expertise zum Studium stellarer Aktivität zu erhalten. Das ist wichtig, denn wenn wir Radialgeschwindigkeitsdaten benutzen, treffen wir häufig auf stellare Aktivität, was die Datengenauigkeit beeinflussen kann. Es ist also wichtig für uns, zu wissen, was sie in Studien zu stellarer Aktivität herausgefunden haben, und wie wir die Signale in unseren Daten entwirren können, um genau die Masse des Exoplaneten abzuleiten. Wir arbeiten außerdem mit einer anderen Gruppe zusammen, die das Innere von Planeten studiert und die Modelle zum inneren Aufbau der Exoplaneten zur Verfügung stellt. Die müssen wir kennen, wenn wir uns mit der fundamentalen Physik der Exoplaneten beschäftigen.
- Hast du Gebrauch von Angeboten des SPP-1992 gemacht?
Ja, ich habe definitiv einige Konferenzen des SPPs besucht, und ich finde diese sind sehr nützlich, um Verbindungen zu anderen Gruppen zu knüpfen, damit ich weiß, was für Exoplanetenforschung am Laufen ist. Das hält mich auf dem Laufenden und ist außerdem ein guter Weg, um mit anderen Exoplaneten-Forschenden in Deutschland in Verbindung zu bleiben.
- Inwieweit hat das SPP-1992 dich und deine Forschung unterstützt?
Im SPP ist es sehr nützlich, dass es ein Reisebudget gibt, das mir Gelegenheit gibt, internationale Konferenzen zu besuchen, um da meine Arbeit außerhalb Deutschlands vorstellen kann, so dass mehr Leute erfahren, was für Forschung wir am DLR betreiben.
- Was könnte man in zehn Jahren über dein Forschungsthema wissen?
Ich hoffe, dass wir in 10 Jahren mit der nächsten Generation an Teleskopen, die sehr bald in Betrieb gehen werden, in der Lage sein werden, unsere Methoden und Techniken zu verbessern, Exoplanetensysteme zu entdecken und zu charakterisieren. In zehn Jahren sind wir also hoffentlich in der Lage, Planeten mit längerer Periode und vielleicht auch Planeten mit einer Umwelt wie die unserer Erde zu finden.
- Was sind deine Hobbies außerhalb der Wissenschaft?
Außerhalb der Forschung mache ich gern Sport, genauer gesagt spiele ich Volleyball.
Interview mit Mathilde Kervazo
- Bitte stell dich einmal kurz vor
Ich bin Mathilde Kervazo und komme aus Saint-Malo in Frankreich.
- An welcher Institution arbeitest du?
Ich arbeite für die Freie Universität in Berlin und habe erst vor zwei Monaten als Postdoc angefangen.
- Wie war dein Werdegang?
Ich habe in meinem Bachelorstudium Geologie studiert und dann einen Master in Planetologie und eine Promotion in Planetologie in Nantes in Frankreich gemacht.
- Wie bist du zur Exoplanetenforschung gekommen?
In meiner Doktorarbeit über Io und Europa habe ich mich mit der Gezeitendissipation beschäftigt und damit, wie man ihr Inneres aufheizen kann. Dann war ich sehr daran interessiert, das, was ich von ihnen gelernt habe, auf andere Planeten in anderen Systemen anzuwenden, die ebenfalls stark durch Gezeiten aufgeheizt werden können.
- Was ist dein Forschungsthema?
Ich beschäftige mich jetzt mit dem Zusammenspiel verschiedener interner Erwärmungen in felsigen Exoplaneten und untersuche, wie dies die Entwicklung dieser Planeten beeinflussen kann.
- Welche wissenschaftlichen Fragen willst du beantworten?
Ich möchte die Auswirkungen der inneren Erwärmung von Gesteinskörpern in Abhängigkeit von verschiedenen Konfigurationen in Bezug auf die Umlaufbahn und den Stern untersuchen, um herauszufinden, wie sich dies auf die Entwicklung auswirkt, und um vielleicht vorherzusagen, welche Art von Aktivität wir für diese Welt erwarten, z. B. vulkanische Aktivität oder ein Magma-Ozean-Stadium, das sich anschließend aus atmosphärischen Eigenschaften oder zukünftigen Messungen ableiten lässt.
- Welche Methoden verwendest du?
Ich verwende die numerische Modellierung, d. h. ich verwende einen 2D-Konvektionscode, der von Lena Noack entwickelt wurde und der die Konvektion in Planetenmänteln im Laufe ihrer Entwicklung über Milliarden von Jahren simuliert.
- Warum findest du gerade dieses Thema interessant?
Es macht mir wirklich Spaß, mir anzuschauen, wie diese Körper zum Beispiel bis zum Schmelzpunkt aufgeheizt werden können und wie sich das auf ihre Entwicklung auswirken kann; auf ihre thermische Entwicklung, aber auch darauf, dass sie sich dadurch aus ihrer Umlaufbahn bewegen können. Und das wirkt sich auch auf die atmosphärischen Eigenschaften und andere Dinge aus, die dann aus Beobachtungen abgeleitet werden können. Also, ja, ich möchte wirklich sehen, wie sie erhitzt werden können. Zum Beispiel Io im Sonnensystem, wo wir sehen können, wie sich diese Hitze in Form von vielen Vulkanen äußert.
- Wo siehst du Verbindungspunkte zwischen deinem Thema und anderen wissenschaftlichen Forschungsfeldern?
Mein Forschungsthema fällt in den sehr weit gefassten Bereich des “Verstehens von Planeten”, insbesondere von Gesteinsplaneten. Indem wir viele Prozesse und die Entwicklung von Planeten vergleichen, können wir auch unsere eigene Erde besser verstehen und herausfinden, warum sie so ist wie sie ist und nicht wie andere Planeten.
- Hast du Gebrauch von Angeboten des SPP-1992 gemacht?
Ja, zum Beispiel kann ich dank der Meetings, an denen ich teilgenommen habe, Kontakte knüpfen und die Gemeinschaft der Astrophysiker besser kennen lernen, denn ich komme aus der Geophysik und den Planetenwissenschaften und kenne die astrophysikalische Gemeinschaft noch nicht, was mir im Moment sehr hilft.
- Inwieweit hat das SPP-1992 dich und deine Forschung unterstützt?
Ich werde vom SPP finanziert, das mich also voll unterstützt, und es ermöglicht mir auch, andere Forscher auf meinem Gebiet zu treffen und mit ihnen zu diskutieren, um mehr über mein neues Projekt zu erfahren.
- Was könnte man in zehn Jahren über dein Forschungsthema wissen?
Ich hoffe wirklich, dass wir vielleicht zwischen Planeten mit Magma-Ozeanen und einer vollständig geschmolzenen Oberfläche und sehr vulkanisch aktiven Planeten anhand der Atmosphäre unterscheiden können, also dank der Beobachter. Wenn wir das wissen, bedeutet das für Leute, die das Innere modellieren, sehr viel, und wir können mehr über Heizprozesse lernen und vielleicht mehr von unserem Sonnensystem verstehen.
- Was sind deine Hobbies außerhalb der Wissenschaft?
Ich wandere gerne und viel, aber Berlin ist dafür nicht der beste Ort.
